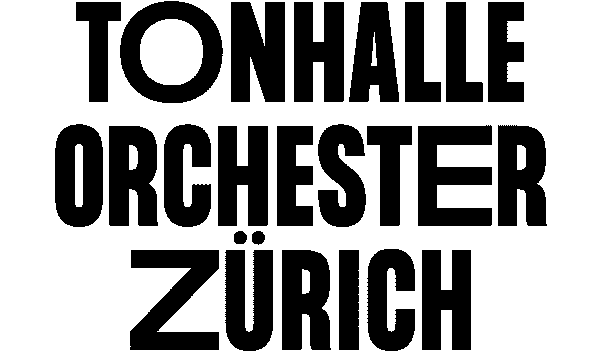Glanzlicht, hoch oben
Haika Lübcke hört gerne zu. Als Flötistin und Piccolistin im Tonhalle-Orchester Zürich und als Vogelliebhaberin in der Natur: Vögel sind ihr fast so lieb wie die Musik. Zwei Welten, die für sie zusammengehören, nicht nur klanglich.
Tock, tock. Wer klopft so früh? Hallo, Bachstelze. Haika Lübcke steht auf, holt das Fernglas. Sie sucht die Misteldrossel, die müsste eigentlich um diese Zeit zu hören sein. «Misteldrosseln singen besonders schön», sagt sie. So: Sie legt das Telefon nieder und spielt eine freundliche Tonfolge auf ihrem Piccolo. Seit zwanzig Jahren ist sie Solo-Piccolistin und zweite Flötistin im Tonhalle-Orchester Zürich. Gerade ist sie in ihrer Ferienwohnung in Amden am Walensee und überbrückt die Zeit des Corona-Lockdowns.
Der leise Glitzer obendrüber
Haika Lübcke beantwortet Fragen zu ihrem Werdegang, zum Instrument: Immer pointiert, nie übereilt. Sie sei die, die an sich lieber zuhöre, auch im Orchester. Da ist sie oft die Letzte, die spielt, jedenfalls als Piccolistin. «Man lauscht den anderen und freut sich über deren Musik», sagt sie. Aber wegträumen, das geht nicht. Der Geist muss wach bleiben und die Hände warm. Zum Beispiel in Tschaikowskys vierter Sinfonie: «Die Gefürchtete einer jeden Piccolistin. Vierzig Minuten warten, dann, zack» – Haika Lübcke greift zum Instrument: «Erst die bekannte Stelle hier, dann zweimal diese vier Sekunden, die man ohne Einspielen hinbekommen muss.» Rasant reiht sie Ton an Ton, das flinke Solo aus dem Nichts. Zack.
«Sehr hoch und sehr leise, darin liegt die Herausforderung», gerade in der Tonhalle Maag, die akustisch ganz anders funktioniert als die Tonhalle am See. Das Volumen der Maag ist um einen Drittel kleiner, auch das Piccolo klingt dort weniger sanft wegen der kürzeren Nachhallzeit, der Klang mischt sich schwieriger mit den anderen Instrumenten. «Vorsichtig anzuspielen, den Obertönen mit scheinbarer Leichtigkeit Glitzer einzuhauchen, das lag mir aber immer recht gut», sagt sie, ein kleines, feines Glanzlicht über den Orchesterklang zu rieseln, das sei ihre Freude.
Die Flöte kam zugeflogen
Haika Lübcke ist 1972 in Celle bei Hannover geboren und auch da aufgewachsen: Immer präsent war zuhause der Ibach-Flügel ihrer Grosseltern, an dem sie im Alter von fünf Jahren zu spielen begann und auch unterrichtet wurde. Da sei diese nette Dame gewesen, die sich um die Blockflötengruppe im Ort gekümmert habe. «Weil ich die recht ordentlich spielen konnte, drückte sie mir eine Bassblockflöte in die Hand.» Ähnlich ging es mit acht Jahren auf der Trompete weiter, die sie sich selbst beibrachte, um in einem Posaunenchor mitzuspielen.
Und dann sah sie dort dieses zarte, dieses glänzende Instrument und war überglücklich, als sie unter dem Weihnachtbaum ihren Wunsch erfüllt vorfand: Eine Flöte. «Ich konnte von Beginn weg spielen. Einfach so. Das kam mir zugeflogen», sie scheint sich noch heute darüber zu wundern, warum und woher eigentlich. Ein Jugendsinfonieorchester jedenfalls zog sie nie in Betracht, das sei doch für die anderen, ihre Eltern seien schliesslich auch keine Musiker. Bis sie dann bei einem Wettbewerb nach dem anderen von sich reden machte, später begleitet von ihrem heutigen Mann am Klavier. Also vielleicht doch Flöte studieren? «Und später dann was Richtiges», wie sie ihren Eltern versprach, «Architektur» – dazu ist es nicht gekommen.
Spätestens, als ihre Professorin Erdmuthe Boehr an der Hochschule in Hannover ihr ein Piccolo in die Hand drückte, gab es kein Zurück. Sie bat sie, den zweiten Satz aus dem Mozart Flötenkonzert zu spielen: «Im ersten Moment dachte ich noch, Gott, das ist verrückt und furchtbar, dieses schöne Konzert mit diesem Ding zu spielen.» Auch das aber fiel ihr leicht, und sie war begeistert. Und die Professorin förderte sie, und forderte sie: «Haika, es wird jetzt Zeit, dass du Ellbogen zeigst», habe sie gesagt und: «Geh weiter.» So besuchte Haika Lübcke internationale Meisterkurse und wurde am Mozarteum in Salzburg bei Michael Martin Kofler aufgenommen. Sie lernte sich freizuspielen, frei auch von Ängsten, dass da draussen immer noch einer mit seiner Goldflöte besser, glänzender, brillanter sein könnte. Und sie spielte sich ganz an die Spitze.
Mit Atemnot zu Solostelle
Gerade ein Jahr dauerte es, bis sie ihr erstes Stellenangebot erspielt hatte: Begonnen beim Staatstheater am Gärtnerplatz und bei den Münchner Symphonikern führte ihr Weg sie über das Tonhalle-Orchester Zürich als Zuzügerin zum Symphonieorchester des Bayrischen Rundfunks und zu den Berliner Philharmonikern.
Aber eins nach dem andern. Es kam die erste Einladung zum Probespiel aus Zürich, ihr erster Besuch überhaupt in der Stadt. Zwar wurde niemand ausgewählt, aber unterwegs zum Hotel traf sie auf den Hans Martin Ulbrich, damals Englisch-Hornist im Tonhalle-Orchester Zürich und ein alter Freund ihrer Eltern. «Wie schön du gespielt hast, Haika», habe er gesagt, sie unter seinen Regenschirm genommen und ihr bei strömendem Regen Zürich gezeigt. Irgendwo zwischen dem Kaffee Schober und der Tobler Villa habe sie sich in die Stadt verliebt und beschlossen, so lange bei diesem Orchester probezuspielen, bis es klappt. Das geschah beim dritten Versuch im Jahr 2000: Ausgerechnet dann, als sie bei Ulbrichs Familie übernachtet hatte und atemlos eine Katzenallergie festgestellt hatte. Es folgte ein Lehrauftrag für Piccolo an der Musikhochschule Luzern und einer an der Zürcher Hochschule der Künste. Und es folgten drei Söhne: Allesamt begeisterte Musikschüler. Ob sich die Mutter ihren Weg für die Kinder wünscht? «Nein», sagt sie. Es gebe zu wenig wirklich gute Stellen. «Und der Weg ist belastend, auch psychisch.»
In Zürich wohnt die Familie am Stadtrand, in Wollishofen. Seit sieben Jahren, seither kommt auch die Amsel vorbei: Sie pfeife eine rare Melodie, es müsse immer dasselbe Tier sein. Wieder zieht sie das Piccolo und spielt sie nach. Dort sei es schwierig zu üben, sie wechsle zwischen Tonhalle Maag und einem Studio in der Nähe. In Amden aber exerziert sie mit Zeit und Musse die wenige bestehende Sololiteratur für Flöte und Piccolo durch. Und überhaupt Musik, die sie gerne hat. So auch Messiaens Orchesterwerke, die für ihre Instrumente Vogelstimmen imitieren.
Und sie lauscht mit ihren Kindern jenen Vogelstimmen, die es unten in der Stadt nicht zu hören gibt. Das ist es, was sie ihnen wünscht: Dass sie hinzuhören lernen, die sinnliche Erfahrung machen, inmitten eines Ensembles zu musizieren. Vielleicht am Ende auch das Gefühl, einen leisen Glanz oben drüber zu rieseln.