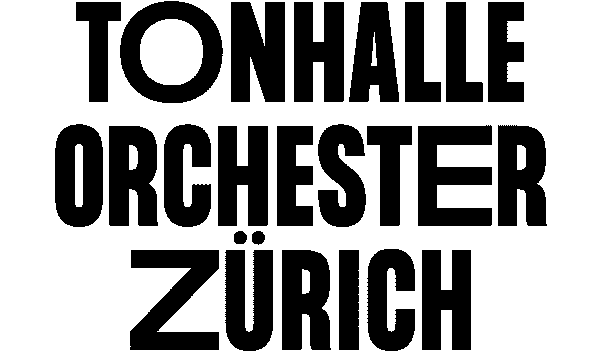Was Worte nicht sagen und Augen nicht sehen
Der neue Mann an den Tasteninstrumenten im Tonhalle-Orchester Zürich heisst Hendrik Heilmann. Wie der Berliner mitten im Corona-Lockdown seine Stelle angetreten hat, warum er nicht an Zufälle glaubt und was ihm für ganze zwei Wochen wortwörtlich die Sprache verschlug.
Ein paarmal doch sass Hendrik Heilmann am Klavier, seit er seine Position beim Tonhalle-Orchester Zürich an den Tasteninstrumenten im wohl sonderbarst möglichen Jahr angetreten hatte. Er begann im April. Dann gerade, als es wegen des Corona-Lockdowns für lange Wochen still wurde in den Konzertsälen. So viele schöne Projekte habe er von Berlin aus voller Vorfreude vorbereitet, entsprechend enttäuscht und dann erfüllt von Tatendrang sei er gewesen, als er im Juni sein Orchester kennenzulernen begann: Er spielte Programme mit gewichtigen Passagen am Klavier, bis die Musik im November wieder auf unbestimmte Dauer verstummte.
Von diesen ersten Konzerterlebnissen mit seiner neuen Musikerfamilie schwärmt er, davon, wie er sich hier vom ersten Tag an aufgehoben und willkommen gefühlt habe. Es sei in diesen Zeiten besonders faszinierend, die Kraft eines Konzerts zu erleben: «Sie schafft Momente, in denen alle berührt, ja ergriffen sind, auf der Bühne wie im Saal. Das ist Magie», sagt er. Das Klangvolumen sei auch etwas Physisches, mittendrin zu sein, treffe einen körperlich. Mit seiner neuen Stelle Teil dieser Erfahrung im Tonhalle-Orchester Zürich zu sein, das gebe ihm Befriedigung und erfülle ihn mit Freude.
Im Oktober vergangenen Jahres reiste Hendrik hierher für sein Probespiel. Jahrzehntelang hat der heute 41-jährige freischaffend gearbeitet, die Zeit ist gekommen, in der er sich beruflich mehr Struktur gewünscht hat. Zudem ist seine Frau Schweizerin, aufgewachsen in Balsthal im Kanton Solothurn, wo seine Schwiegereltern ihn beheimaten, wann immer er beruflich im Land ist. Langfristig kann sich das Paar gut vorstellen, gemeinsam herzuziehen, Hendriks Frau vermisst ihre Heimat, er selbst fühlt sich hier wohl, er mag den freundlichen und respektvollen Umgang untereinander, wie er sagt. Kennengelernt hat er sie bei einem seiner Engagements für die Berliner Philharmoniker, sie ist dort als Geigerin engagiert.
Hendrik überzeugt auch in Zürich seit seinen ersten Tastenschlägen: Begeistert erzählten jene, die damals bei seinem Probespiel in der Tonhalle Maag zugegen waren, dass man einen wunderbaren Musiker erlebt habe – eine Klasse für sich, hiess es. Erleichterung war spürbar, ersetzt Hendrik doch mit dem pensionierten Peter Solomon eines der dienstältesten Mitglieder des Tonhalle-Orchesters Zürich, das für Können und Menschlichkeit gleichermassen hochgeschätzt wurde und wird.
Vom Sinn seines Tuns
Hendriks Stimme ist leise, er spricht besonnen, mit Bedacht. Gelassen und gleichzeitig fokussiert erzählt er von seinem Weg, als wären Worte Pfeile, die er in einen Bogen spannt, obwohl er doch eigentlich an das Unaussprechliche glaubt: «Heute bin ich der Überzeugung, dass wir keine beliebige Anordnung von Atomen und Molekülen sind. Es gibt Vieles, das wir nicht ermessen können. Die Existenz, die Seele.» Der Mensch, sagt Hendrik, könne nach seiner jüngeren Überzeugung kein biologisches Zufallsprodukt sein. «Da glaube ich sehr stark an eine grosse Kraft, an eine Energie, die verantwortlich ist dafür, was wir um uns sehen und wahrnehmen und eben viel mehr noch für all dies, was wir nicht wahrnehmen können.» Neulich habe er in einem wissenschaftlichen Artikel gelesen, dass gerade mal rund fünf Prozent dessen, was existiere vom Menschen wahrnehmbar sei. Etwa 95 Prozent eben nicht. «Wenn etwas von den 95 Prozent mittels der Musik an einem Abend im Konzertsaal zum Vorschein kommt, dann ist es dies, was ich als religiös bezeichnen würde.» Das präzise sei der Sinn seines Tuns.
Geboren in Friedrichshain, im Osten Berlins und zehn Jahre vor dem Mauerfall, fühlte er sich schon immer dem Klavier zugehörig, tröstete sich spielend, reagierte sich ab, dachte nach. Kindheitsbilder auf einer Krabbeldecke unter dem Notenständer seines Grossvaters erinnern ihn daran, Opa war Solofagottist an der Staatsoper in der Staatskapelle Berlin. Er besass ein grosses, schwarzes Klavier mit Elfenbeintasten und zwei Kerzen, das noch heute bei einem von Hendriks Freunden steht. «Ich habe wohl nie gehämmert», so hat man es ihm erzählt. Seine Eltern kauften ihm ein eigenes, kleines Kinderklavier, brachten ihn mit fünf Jahren an eine musikalische Vorschule, in der es herauszufinden galt, welchen Kindern eine Förderung angedeiht werden sollte. Hendrik hatte das Glück, dass jemand seinem Vater im Laienchor zum Kontakt zu Dieter Zechlin verhalf, einem der renommiertesten Pianisten der damaligen DDR. Nachdem er von sechs bis elf bei einer liebevollen Klavierlehrerin Unterricht bekam, spielte er also in Zechlins Wohnzimmer, während dieser sich mit seinen Eltern unterhielt und zeitgleich beschloss, Hendrik als seinen Schüler aufzunehmen und zu fördern.
Mitgehen und loslassen
Es folgten ein Studium an der Hochschule für Musik «Hanns Eisler» in Berlin, Meisterkurse und diverse Auszeichnungen und Preise, Stipendien, seit 2005 Lehraufträge an beiden Berliner Musikhochschulen, ein glanzvolles Debüt bei den Salzburger Festspielen, regelmässige Engagements beim Festival in Aix-en-Provence. Kammermusik, die Faszination für Wort und Musik, deshalb eine intensive Arbeit mit Sängerinnen und Sängern, die Berliner Philharmoniker.
Und Hendrik ist Vater von Zwillingen geworden, im August sind seither sieben Jahre verstrichen. Die Geburt seiner Tochter und seines Sohnes hat ihm die Sprache verschlagen, für ganze zwei Wochen, so unvermittelt und überwältigend traf ihn das Ereignis. Ganz klar sei das der einschneidendste Moment in seinem Leben gewesen.
Hendrik liebt lange Spaziergänge und nimmt dabei aus der Stille heraus Kraft und Inspiration mit ans Klavier. Die Musik hat ihm eine Lektion gelernt, die er in seinen Alltag überträgt: Als einzige der Künste laufe sie in einer zeitlichen Horizontale ab. «Sie ist immer in Bewegung. Man kann sie nicht festhalten.» Wenn man es nicht schaffe, Veränderungen zuzulassen, dann werde das Leben unweigerlich zur unlösbaren Aufgabe. Wenn er zum Beispiel Bach oder Beethoven hört oder spielt, dann fühlt er sich bestätigt: «Es gibt Dimensionen, die sind nicht von dieser Welt.» Im Konzert gebe er deshalb in allen Formationen, zu zweit oder im Sinfonieorchester, alles für die Summe. Mitgehen und loslassen. So will er sich auch in Zürich einbringen mit allem, was er zu geben hat. Im nächsten Jahr wieder für die Magie im Saal. Bestimmt.