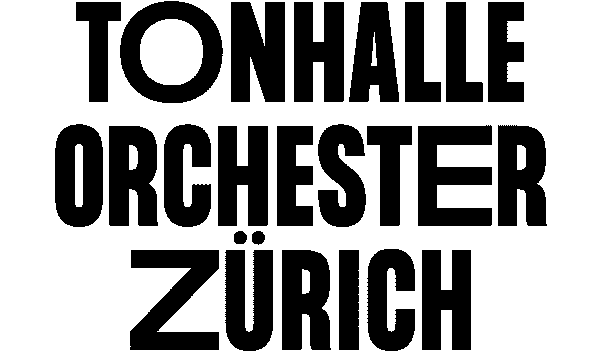Mit Disney ins Orchester
Sarah Verrue ist die Harfenistin des Tonhalle-Orchesters Zürich. Wer mit einem Instrument in ein Toporchester wolle, von dem es nur ein einziges brauche, der müsse streng sein mit sich, sagt sie. Sarah ist es. Dabei hat ihr Weg zur Harfe verträumt begonnen: Mit einer ziemlich verführerischen Katze.
Sarah Verrue sitzt zwischen einer grossen und einer kleinen Harfe: Ihr Homeoffice in der Wohnung in Altstetten, aus dem sie anruft. Die grosse Harfe gehört ihr, Sarah hat seit 2013 die einzige Harfenistinnenstelle im Tonhalle-Orchester Zürich inne. Die Kleine hat sie ihrem sechzehnmonatigen Rafael geschenkt, weil er immer bei ihr mitspielen will, sich am Instrument hochzieht und auf den Sockel stellt, mit ihrer Stimmgabel auf die Saiten klopft: «Er scheint eine Vorliebe für neue Musik zu haben», sagt sie.
Harfe statt Kuhherde
Rafael ist gerade mit seinem Vater unterwegs: George Cosmin Banica, zweiter Konzertmeister im Orchester. Im Corona-Lockdown wechselt sich das Musikerpaar mit der Betreuung von Rafael ab, während die Kinderkrippe geschlossen ist. Normalerweise üben die beiden lieber Zimmer an Zimmer in der Tonhalle Maag, jetzt müssen sie sich anders organisieren. Nicht zu üben gehe nicht, wenn man sein Niveau halten wolle. Besonders intensiv hat Sarah das zuletzt bei den Vorbereitungen auf das Heinz Holliger-Programm vergangenen November erfahren. Bei den Konzerten dann konnte sich das Publikum von ihrem Niveau überzeugen – während zwei Monaten hat sie täglich Stunden auf ihre Leistung hingearbeitet. Es sei das schwierigste Orchesterwerk gewesen, das sie bisher gespielt habe. Ob sie selbst wie ihr Söhnchen ein Faible für neue Musik hat? Sie sei oft aufwändig und hoch anspruchsvoll im Entziffern, dann aber eröffne sich oft eine Welt, «wenn erst mal verstanden ist, mit welchen Stäbchen man an welchen Saiten kratzen soll», Sarah lacht.
Es hätte alles ganz anders kommen können. Alle in ihrer Familie sind Bauern, die Eltern, deren Eltern, der Bruder. Auch Sarah ist auf einem Bauernhof in Kuurne aufgewachsen, im flämischen Teil Belgiens, wo sie 1988 zur Welt kam. Sie hat ihre Kindheit inmitten von 60 Kühen und weiten Gemüsefeldern verbracht. Und inmitten von unendlich viel Arbeit, da kam ihr das Üben gerade recht. Wenn sie übte, musste sie nämlich nicht helfen. Das war aber nicht der Grund, warum sie so angefressen war, warum sie ihren Kindertraum aufgegeben hatte und keine Tierärztin wurde. Seit sie mit neun Jahren «Aristocats» sah, war es um sie geschehen, da spielte eine der Katzen Harfe, verführerisch und wunderbar. Der Zufall wollte es, dass in der Schule eine Harfenistin vorbeikam, um ihr Instrument vorzustellen, wie Sarah selbst das heute auch tut. Sie ging nach Hause, stellte sich vor ihre Mutter und sagte, dass sie Harfenunterricht wolle. Die Mutter kannte das Instrument zwar nicht und in ihrer Stadt unterrichtete es auch niemand. Aber sie unterstützte die Tochter und liess sie gewähren.
Mini-Gesellschaft mit gemeinsamem Nenner
Rasch war klar: Halb ist keine Option. «Wer mit der Harfe in einem Toporchester landen will, der muss es sich abverlangen», sagt sie. Das sei natürlich auch mit jedem anderen Instrument so, bloss sei die Chance eben noch kleiner, wenn es nur höchstens eine Stelle pro Orchester gebe. Mit siebzehn bewarb sie sich am Conservatoire National Supérieur de Paris, wo jährlich nur zwei Plätze vergeben werden. «Hätte das nicht geklappt, hätte ich es bleiben lassen mit der Musik. Ganz oder gar nicht.» In diesem Sinne zog sie mit 22 Jahren weiter nach Berlin, um dort bei Marie-Pierre Langlamet zu lernen, der Soloharfenistin der Berliner Philharmoniker. Sarah wurde in die Karajan-Akademie aufgenommen, der Nachwuchsschmiede des Orchesters ihrer Lehrerin, bis sie nach einem Jahr in Zürich vorspielte. Es klappte auf Anhieb. «Es ist nicht selbstverständlich, wenn die erste Stelle gleich eine Traumstelle ist», sagt sie. Sie könne es kaum erwarten, bald mit den Kolleginnen und Kollegen auf die Bühne und in die Normalität zurückzukehren.
Noch geniesst sie die Ruhe, sie war nämlich krank: Kein Geruch und kein Geschmack, schlimm gehustet, Fieber während Wochen. Sarah und ihre kleine Familie erholt sich von anstrengenden Zeiten, in denen sie wohl gegen Covid19 gekämpft hatte. Getestet wurde nicht. Und gleichzeitig freut sie sich aber sehr auf die Rückkehr in die Normalität, auf die «Mini-Society», wie sie das Tonhalle-Orchester Zürich nennt. Menschen allen Alters und aller Herkunft, verrückte, vergnügte, nachdenkliche Typen. Jeweils nach den Ferien mit dem Proben zu beginnen, sei stets wie ein zweites Heimkommen. «Wir im Orchester haben den wundervollsten gemeinsamen Nenner», sagt sie. «Die Musik.»