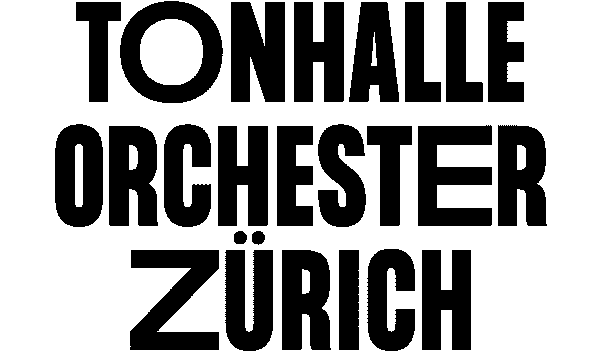Sylvia Caduff – die Pionierin am Dirigierpult blickt zurück
Zu einer Zeit, als in den Statuten von manchen Orchestern noch festgehalten wurde, dass keine Frau das Orchester dirigieren dürfe und die Schweiz noch Jahrzehnte vom Frauenstimmrecht entfernt war, hatte Sylvia Caduff nur ein Ziel: Sie wollte Dirigentin werden.
1963 stand sie, später Schülerin Herbert von Karajans und Assistentin Leonard Bernsteins, als allererste Frau am Dirigentenpult des Tonhalle-Orchesters Zürich.
Sylvia Caduff, Ihnen ging es immer um die Sache, um die Musik. Sie wollten Dirigentin werden und liessen sich von niemandem von diesem Ziel abbringen. War Ihnen zu Beginn überhaupt klar, welch aussergewöhnlichen Weg Sie da als junge Frau gewählt hatten?
Nein. Das war mir keineswegs bewusst. Ganz zu Beginn sagte man mir: «Du kannst doch nicht Dirigentin werden. Frauen machen das nicht.» Ich verstand das von den Worten her schon, aber die wirkliche Bedeutung war mir nicht klar. Ich fand, Frauen machen ja alles andere auch: Sie spielen Geige, Klavier, jedes Blasinstrument – da ist das Dirigieren doch nichts Besonderes.
Und wie war das in der Realität?
Viele Orchester akzeptierten mich ohne weiteres. Einige wenige hatten Probleme zu verstehen, dass da jetzt kein Mann vor ihnen stand. Dadurch habe ich mich aber nicht angegriffen gefühlt. Vielleicht war das auch mein Schutz.
Sie liessen sich nicht abbringen, verfolgten Ihren Weg und durften 1963, nach einem Meisterkurs bei Rafael Kubelik, und mit gerade mal 24 Jahren zum ersten Mal das Tonhalle- Orchester Zürich leiten.
Ich hatte das Glück, dass ich im Schlusskonzert bei Rafael Kubelik das Adagio aus Mahlers 10. Sinfonie dirigieren durfte. Dass er mich gerade dieses Werk dirigieren liess, war schon eine Auszeichnung. Daraufhin wurde ich das erste Mal vom Tonhalle-Orchester Zürich eingeladen.
Ihre Karriere ging schnell aufwärts: mit 29 Jahren gewannen Sie als erste Frau den Dimitri Mitropolous-Wettbewerb, dirigierten die Berliner Philharmoniker, die Münchner Philharmoniker, das BBC Symphonie Orchester und waren die erste Frau mit eigenem Orchester. Hatten Sie je Zweifel?
Nein. Und da bin ich meinen Lehrern Rafael Kubelik und Herbert von Karajan, die mich beide gut kannten, sehr dankbar. Rafael Kubelik sagte mir einmal: «Lassen Sie niemals Zweifel aufkommen. Auch wenn jemand etwas anderes sagt, glauben Sie mir, diese Person hat unrecht.»
Meine Zweifel hatte ich auf ganz andere Art und Weise: Ich bin ein Mensch mit grossen Selbstzweifeln, wenn es um die Verantwortung von grossen Werken geht. Als ich Beethovens Neunte Sinfonie zum ersten Mal aufführte, war ich fast 50 Jahre alt.
Konnten Sie trotzdem, obwohl Sie so lange gewartet haben mit gewissen Werken, alles machen, was Sie wollten, oder gibt es noch etwas, das fehlt?
Nein, es gibt nichts, von dem ich sagen könnte: Schade, dass ich das nie dirigiert habe. Ich hatte das Glück, neun Jahre lang Chefdirigentin in Solingen zu sein, und dort konnte ich alles aufführen, was mich interessierte: Von Verdis und Brahms‘ Requiem bis hin zu den Sinfonien von Mahler und Bruckner oder die «Fledermaus» von Johann Strauss, die wir 25 Mal aufführten und die mir grossen Spass gemacht hatte.
Auch beim 25. Mal noch?
Auf jeden Fall! Diesbezüglich hatte ich eine schöne Begegnung. Als ich mit einem Gastorchester auf Tournee war, kam der Konzertmeister gegen Ende zu mir: «Etwas muss ich Ihnen unbedingt sagen: Das haben wir noch nie erlebt, dass der Dirigent auch nach der x-ten Aufführung noch so ein Interesse zeigt. Man hat bei Ihnen keinen Unterschied bemerkt vom ersten bis zum letzten Konzert. Jedes war mit vollster Intensität dirigiert, voller Leben.»
Und das war Ihnen nicht bewusst?
Doch auf jeden Fall! Mir war aber nicht bewusst, dass das bei anderen nicht der Fall ist.
Sie wirken sehr bescheiden. Ist Ihnen denn nun rückblickend bewusst, wie aussergewöhnlich Ihre Leistung war?
Mir ist schon bewusst, was ich erreicht habe. Ich bin deswegen aber nicht ausserordentlich stolz. Stolz bin ich höchstens, weil ich den Weg alleine gegangen bin, ohne Protektion, ohne Agent.